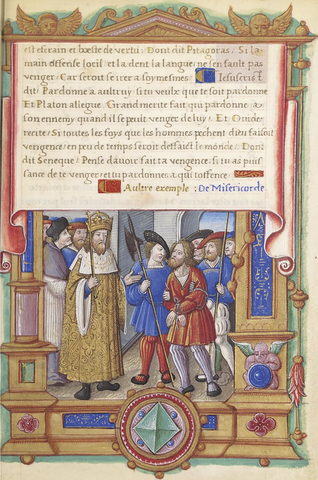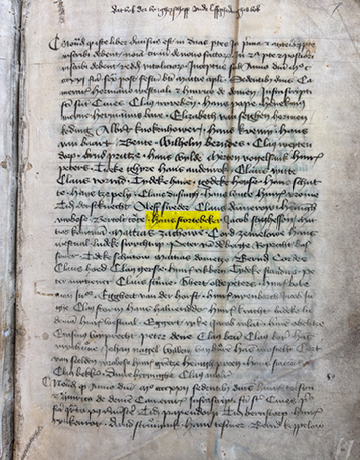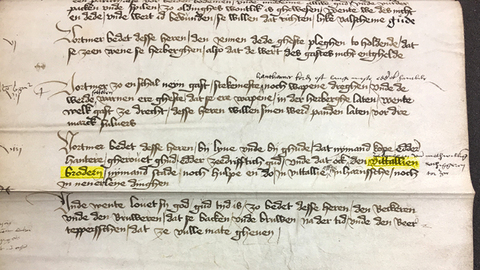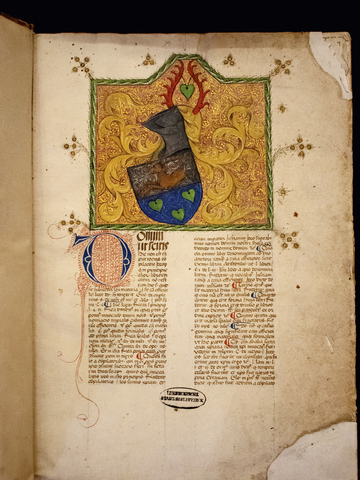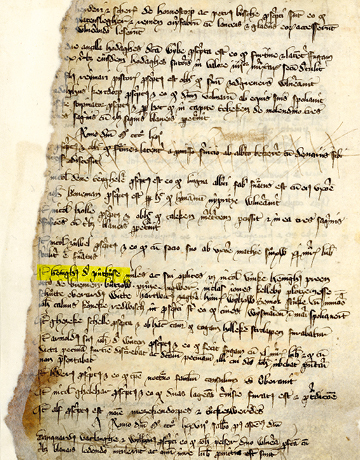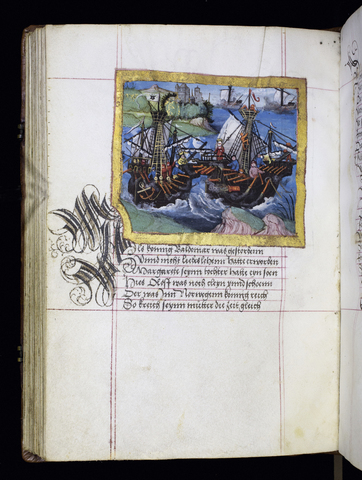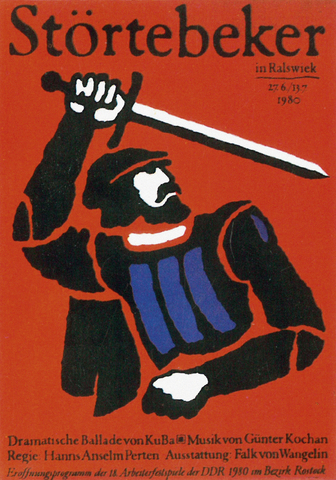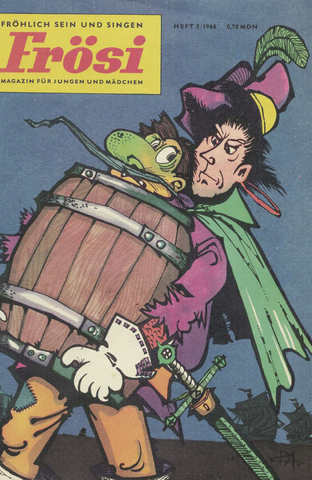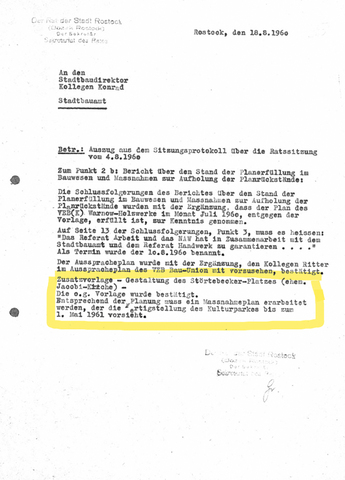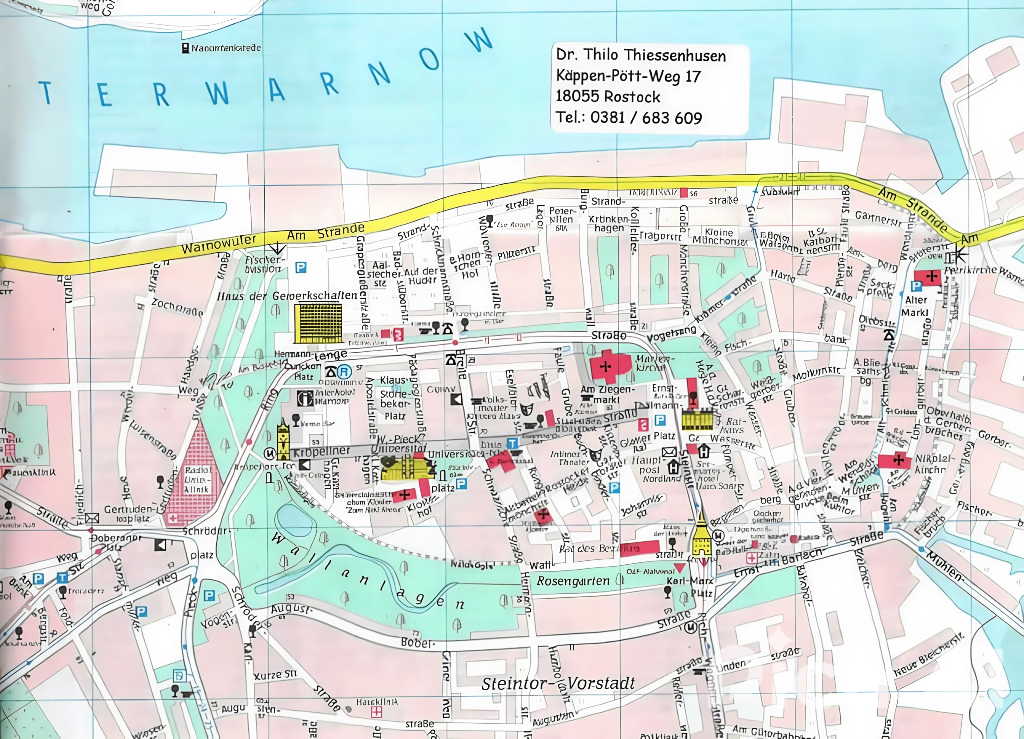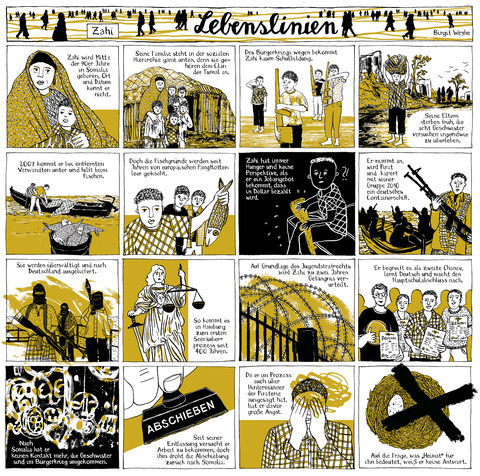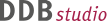Impressum
Die virtuelle Ausstellung Störtebeker in Rostock wird veröffentlicht von:
Historisches Institut der Universität Rostock
Neuer Markt 3 (3.OG), 18055 Rostock
gesetzlich vertreten durch
Prof. Dr. Gregor Rohmann
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Inhaltlich verantwortlich:
Kurator*innen:
Die Ausstellung wurde vorbereitet durch Studierende des Historischen Instituts der Universität Rostock:
Lena Ahrens, Viktor Below, Robert Busch, Ellena Ditscher, Robin Eger, Niclas Elsner, Samuel Frenzel, Tobias Gerding, Emily Hahn, Kati Hefenbrock, Hans Richard Heider, Tarek Hepperle, Magnus Hollatz, Annalena Hordan, Fine Jankowski, Jule Kanold, Finja Knodel, Josephine Kordt, Louis Lietze, Meike Mann, Mario Mittelstädt, Tristan Moeller, Lea Pfaffenbauer, Richard Rogge, Lola Rogowski, Juliane Schmidt, Peer Schulz, Harm Schwerdtfeger, Isabell Seul, Moritz Toussaint, Nele Vahl, Julian Wahle, Sarah Wenger, Niklas Wolf, Johanna Zibell
Leitung
Prof. Dr. Gregor Rohmann und Prof. Dr. Oliver Plessow
(Universität Rostock, Zentrum für regionale Geschichte und Kultur Mecklenburgs)
Kuratorische Unterstützung
Anja Finkous, Szenografin
www.fachwerkler.de
Die Ausstellung ist entstanden in Kooperation mit der Geschichtswerkstatt Rostock e. V. und dem Schifffahrtsmuseum Rostock.
Rechtliche Hinweise:
Die Deutsche Digitale Bibliothek verlinkt die virtuelle Ausstellung auf ihrer Internetseite https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/content/virtuelle-ausstellungen. Dabei wurde auf die Vertrauenswürdigkeit der Institution, welche die Ausstellung veröffentlich hat sowie die Fehlerfreiheit und Rechtmäßigkeit der virtuellen Ausstellung besonders geachtet. Der auf dieser Internetseite vorhandene Link vermittelt lediglich den Zugang zur virtuellen Ausstellung. Die Deutsche Digitale Bibliothek übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der virtuellen Ausstellung und distanziert sich ausdrücklich von allen Inhalten der virtuellen Ausstellung, die möglicherweise straf- oder haftungsrechtlich relevant sind oder gegen die guten Sitten verstoßen.
DDBstudio wird angeboten von:
Stiftung Preußischer Kulturbesitz, gesetzlich vertreten durch ihren Präsidenten,
handelnd für das durch Verwaltungs- und Finanzabkommen zwischen Bund und Ländern errichtete Kompetenznetzwerk
Deutsche Digitale Bibliothek
c/o Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Von-der-Heydt-Straße 16-18
10785 Berlin
Telefon: +49 (0)30 266-41 1432, Fax: +49 (0) 30 266-31 1432,
E-Mail: geschaeftsstelle@deutsche-digitale-bibliothek.de
Umsatzsteueridentifikationsnummer:
DE 13 66 30 206
Inhaltlich verantwortlich:
Dr. Julia Spohr
Leiterin der Geschäftsstelle
Finanzen, Recht, Kommunikation, Marketing
Deutsche Digitale Bibliothek
c/o Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Von-der-Heydt-Straße 16-18
10785 Berlin
Konzeption:
Nicole Lücking, Deutsche Digitale Bibliothek
Stephan Bartholmei, Deutsche Digitale Bibliothek
Dr. Michael Müller, Culture to Go GbR
Design:
Andrea Mikuljan, FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur GmbH
Technische Umsetzung:
Culture to Go GbR mit Grandgeorg Websolutions
Hosting und Betrieb:
FIZ Karlsruhe - Leibniz Institut für Informationsinfrastruktur GmbH